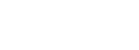FAZ - ARTIKEL als Nachtrag zu meinen „Angelgeschichten“
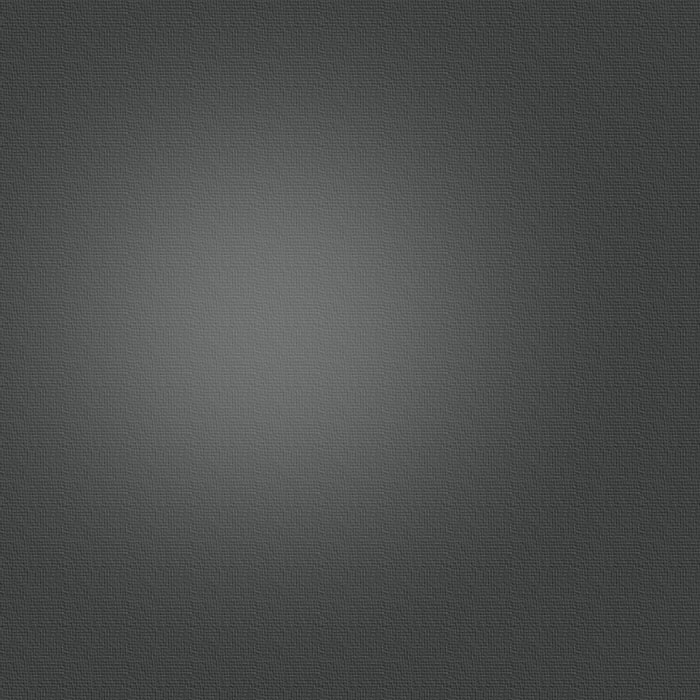

Zum Artikel:
Man kann abstumpfen oder sensibler werden
Ein Besuch beim Angelpfarrer in Offenthal/Lauterkeit und Bescheidenheit am Fischwasser
Dreieich. Einmal hat ein Kollege von der katholischen Fakultät den evangelischen Pfarrer Hans-Werner Schneider zum Angeln mitgenommen. Das liegt rund zehn Jahre zurück und hat ihn nicht mehr losgelassen. Heute gibt es im Pfarrhaus an der Dieburger Strasse in Offenthal außer dem üblichen Arbeitszimmer eines Geistlichen einen Raum im Keller, der nicht minder ein Arbeitszimmer ist. Hier hängen die Ruten und Haken, Rollen, Schnüre, Blinker, Wobbler, Posen, Kescher, Gaff, Lagel, Dosen, Gerätekasten, Köderkessel, Taschen, Stiefel sind ordentlich verwahrt. Aus der Mauer ragen Trophäenköpfe einiger großer Fänge, alles nicht ungewöhnlich für eines Anglers Hobbykeller. Seltener schon trifft man in dieser Zunft auf eine Bücherreihe über die Fischerei, die Unterhaltendes wie Belehrendes enthält und deren vielschichtige Thematik erkennen läßt, daß Schneider seine Leidenschaft kultiviert hat.
Das Besondere aber ist ein langer Tisch unter dem Fenster, auf dem eine Schreibmaschine steht. Hier eben wird gearbeitet, nicht so wie in anderen Hobbykellern, wo Haken geschärft und Fliegen gebunden werden. Hier ist ein Buch entstanden, illustriert mit eigenen Farbfotos, von einem Freund schön eingebunden. Es ist mit Maschine geschrieben. Einen Verleger hat es noch nicht gefunden. Es sind Erlebnisse, die Schneider mit nach Hause gebracht hat, äußerlich geordnet nach dem Alphabet von Aal bis Zander, Gedanken um Fische und Gewässer, mit viel Naturverbundenheit und verhaltenem Einblick in die Psyche der Angler.
Ein Paar Beschreibungen sind in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden. Aus manchen Formulierungen und Andeutungen läßt sich auf eine mit den Jahren gewandelte Einstellung des Autors zu seiner Passion schließen. Der renommierte Naturschützer Horst Stern wirft den Petrijüngern Tierquälerei vor. Sie fischten „im trüben und im grauen Grenzbereich des Tierschutzgesetzes. Die Rekordjagd, die Kilogrammhuberei, das Mehrfachangeln derselben Fische sind, nimmt man den Gesetzgeber beim Wort, Verstöße gegen gegen Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes“. Das von Stern herausgegebene Organ sagt aber auch:“Im Idealfall, wenn der Haken richtig sitzt und der Fisch an Land waidgerecht behandelt wird, stirbt die Beute ohne große Qual.“ Die Angler reagieren darauf betroffen, und viele fühlen sich nicht mehr wohl.
Pfarrer Schneider weiß um den Zwiespalt, begegnet ihm und kann sich ihm doch nicht entziehen. Einmal berichtet er:“Eine Barbe kämpft um ihr Leben.“ Von einem Kampf der Verzweiflung jedoch, von dem andere sprechen, will er nichts wissen. Das Wort stamme aus einer anderen Kategorie, und Vermenschlichung sei fehl am Platze. Da konstruiere man eine gedankliche Qual. Unbewußt, fast im gleichen Atemzug, redet er von den stets zur Flucht vor raubgierigen Feinden bereiten Tieren, die sich in einem Dauerstreß befinden. Im gleichen Zustand sei der Fisch am Haken, der versucht vom Widerstand wegzukommen. Verzweiflung, Qual, Streß - es sind ebenbürtige Metaphern, und man weiß nicht, wie sonst der Mensch einschätzen könnte, was die Kreatur betrifft.
Seit dem Angeltag mit dem katholischen Kollegen ist für Schneider Drill das schönste. Man dürfe ihn nur nicht unnötig verlängern. Da bedrückt ihn nichts. Das ist jedoch bei den entsetzlichen Szenen der Fall, die er am selben Tag beobachten mußte. Man befand sich an einem der von ihren Besitzern und Pächtern als Forellensee angebotenen Gewässer. Das sind jene Freizeitteiche, , wo jedermann, habe er Vorkenntnisse oder nicht, herausholen kann, was anbeißt. Die Forellen, manchmal auch Karpfen und Schleie, sind wenige Tage vorher in fangreifen Größen eingesetzt worden.
Wer mitmachen will, bezahlt die verlangte Gebühr, und dann wird “Wurm brutal“ gefischt. Ist viel herausgeholt worden, wird der „Bestand“ mit neuen Lebewesen ergänzt. Was geschieht sei „ganz furchtbar“. Die Fische werden am Haken hochgehoben, über den Sand am Ufer geschleift, mit der einen Hand unterstarkem Druck gegriffen, während mit der anderen Hand der Haken aus dem Maul gerissen wird. Dann wird das Opfer in einen Setzkescher aus Draht gegeben, wo es sich an den Maschen wund reibt. Manche stecken es nach einem Schlag auf den Kopf in einen Plastikbeutel, wo es elendiglich seinem Ende entgegenzuckt.
So sieht eine weit verbreitete kommerziellen Interessen unterworfene Tierquälerei aus. Die dagegen vorgebrachten verbalen Beanstandungen verschwinden unter einer Flut von Werbeprospekten und anreißerischen Inseraten in Fach- und Lokalblättern. Noch keine Organisation, keine Aufsicht, keine Behörde ist bisher dagegen eingeschritten. Schneider führt die Hand noch im Wasser weich unter den Leib des gehakten Fisches und löst vorsichtig den Haken, so daß das Tier unverletzt in sein Element entlassen werden kann. Wir es gehältert, dann im großen, geräumigen Netzkescher,der tief ins Wasser hängt. Auch von da kann dem Fisch jederzeit die Freiheit wiedergegeben werden. Was Schneider mitnimmt, wird mit einem einzigen harten Schlag betäubt. Vor allem größere Fische kann man dann abstechen, damit sie ausbluten . alles kurz und schmerzlos, sagt der Mensch.
Fischen, Jagen, Sammeln sind dem Menschen von jeher eigen, und der Drang nach Beute ist natürlich, gewissermaßen ein Rest an Raubtier in uns. Das hängt der Angelei an, nicht anders wie der Jagd. „Wenn man lange angelt, kann man abstumpfen, man kann aber auch sensibler werden“, meint Schneider. Man kann sich Regeln auferlegen, die einen naturhaften Trieb zügeln oder, wenn man so will, zivilisieren. Der Tauwurm, den man auf den Angelhaken aufzieht, löst eine Scheu aus. Wenn dann ein Fisch beißt, denkt man nicht mehr an den aufgespießten, sich windenden Wurm.
Toter oder lebendiger Köderfisch, das ist eine seit langem umstrittene Frage. Für den Pfarrer ist sie gelöst. Lebend wird kein Fisch als Köder ausgeworfen. Dem Zander wird genau wie dem Aal der kleine getötete Fisch oder der Fetzen eines getöteten Fisches angeboten. Auf Hecht benutzt er nur noch Blinker oder Wobbler. Diese Art ist zudem mit Bewegung verbunden, verlangt eine besondere Technik, die einige Mühe und Übung bedarf, und der Fisch, in der Regel ganz vorn gehakt, kann unverletzt freigelassen werden. Der Pfarrer fragt sich, warum in Deutschland Angler, Fachorgane und Verbände, oft nach leidenschaftlicher bis unleidlicher Debatte, nicht auf den lebenden Köderfisch verzichten wollen, sei doch ausgerechnet in der Republik Irland, deren Seen und Flüsse in ganz Europa als ausgezeichnete Hechtgewässer gerühmt und von vielen deutschen Anglern mit Erfolg besucht werden, der lebende Köderfisch verboten.
Alles in allem, der Mann in Offenthal hat die umstrittenen Probleme früh erkannt und bewältigt sie. Er versteht nicht, wie Leute der Fischwaid nachgehen mit der einzigen Absicht, soviel wie möglich aus dem Wasser an Land zu ziehen, ein Grundsatz übrigens, nach dem die allerorts propagierten Wettfischen zum Massenfang aufrufen. Da schäumt der Rest Raubtier im Menschen über, der nicht aufhört wie das Tier, wenn es den Hunger gestillt hat, sondern maßlos wird und sich an der Natur vergreift. Der Pfarrer verhält sich umgekehrt. Er beschränkt den Fang und zieht, von Jahr zu Jahr intensiver, das Erlebnis in der Natur der Beute vor.
Ein Reiher, der im Morgennebel über den Teich streicht,ein Mauswiesel, das aus den Brennesseln hervorkommt und sich mit der Angeltasche beschäftigt, machen zufrieden für den ganzen Tag. Der Montag jeder Woche ist dienstfrei. Das ist der Pfarrersonntag. Da geht es hinaus. Einmal bläst ein starker Wind. Ein Kohlweißling wird niedergedrückt und taumelt auf dem Wasser. Zwei Döbel stehen dicht unter der Oberfläche. Der größere schwimmt einen Bogen, beobachtet das Flattern und stellt sich in Position. Dann schießt er los und schnappt sich den Falter. Der zweite Fisch will es ebensogut haben und schnappt daneben. „So etwas ist mir lieber, als einen Fisch zu fangen.“
Wenn Schneider einen hat, geschieht es immer öfters, daß er ihn vorsichtig drillt, leicht in der Hand wiegt und mißt, seine „fast drehrunde, schlanke und dabei muskulöse Gestalt bewundert und ihn seinem Element zurückgibt“. Es war eine seiner besten Barben. Er hätte sie als Trophäe nach Haus mitnehmen können.
WERNER ECKHARDT