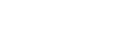Das Yukon - Holz
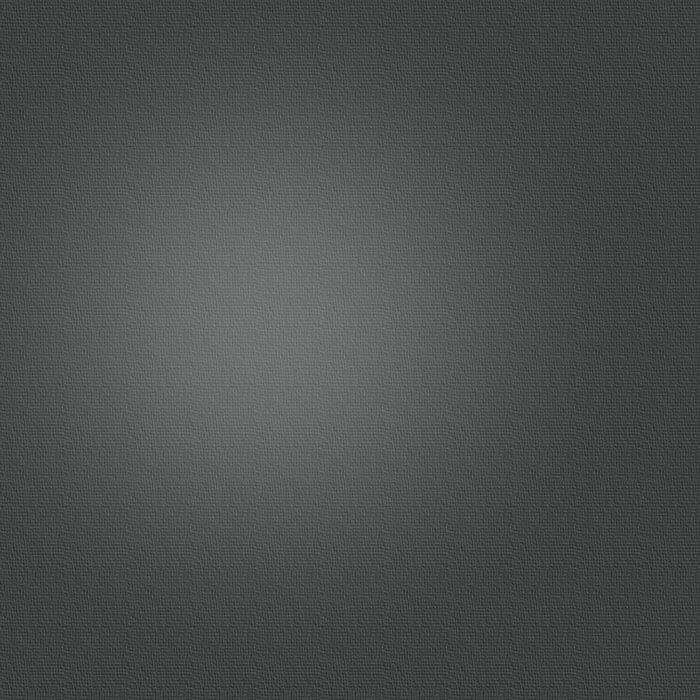
Auf der Suche nach dem Ursprünglichen
Vorwort
Bereits im Jahre 1855 hielt Chief Seattle, Häuptling der Duwamish-Indianer, als Antwort auf das Ansinnen der amerikanischen Regierung, vertreten durch den damaligen Präsidenten Franklin Pierce, das Land der Indianer kaufen zu wollen, seine mittlerweile berühmt gewordene Rede, die in ihrer kompromisslosen Klarsicht der Sachverhalte, in ihrer tiefblickenden Einsicht in die Lebenszusammenhänge von Mensch und Natur und in ihrer geradezu prophetischen Weitsicht, was die bis in unsere Gegenwart hineinreichenden Probleme und Konsequenzen anbelangt, in einzigartiger Weise wichtig und beachtenswert ist.
Unter Titeln wie: „Meine Worte sind wie Sterne“, „Wir sind ein Teil der Erde“, „Wie kann man den Himmel verkaufen?“ oder „Die Erde gehört nicht uns. Wir gehören der Erde“ sind seine Worte und Gedanken in mehrfacher Ausgabe im Buchhandel erhältlich.
Auf der gedanklichen Suche nach dem Ursprünglichen, zu der mich das Yukon-Holz angeregt hat, bin ich immer wieder auf jene Ausführungen zurückgekommen und zitiere daraus, um meine eigenen Vorstellungen und Empfindungen durch sie zu präzisieren und zu untermauern.
Wenn auch Häuptling Seattle und seine Duwamish im einstigen Indianerland der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika und nicht im Yukon-Territory Kanadas lebten, so sind seine Einsichten und Mahnungen dennoch nicht nur leicht dorthin übertragbar, sondern für das Zusammenleben von Mensch und Natur in einem jedem Teil unserer Welt von außerordentlicher Bedeutung.
Hans-Werner Schneider Rüsselsheim, im April 2001

Irgendwo
Irgendwo am Ufer des Flusslaufes, der die überschüssigen Wassermassen des Louise Lake in den Kathleen Lake leitet, hatte sie gestanden, eine Schwarzfichte wie viele andere neben ihr, war in den kurzen Frühlings- und Sommerwochen zu neuem Leben erwacht, hatte Äste, Zweige, Nadeln, Samen und Früchte hervorgebracht und ihr Leben in der langen kalten Frost- und Winterzeit gedrosselt. Allzu hoch hatte sie ihren Wipfel in den Jahren ihres Wachstums nicht in den Himmel erhoben, nur etwa gut 15 Meter, so wie es sich für eine wahre Black-Pine des Yukon geziemt.
Viele Male war der Wechsel der Jahreszeiten an ihr vorübergezogen. Sie hatte die Erstarrung in Eis und Schnee erlebt, das Bersten des Flusseises im späten Frühjahr, die der Wärme folgenden Moskitoschwärme, die Sonnestrahlen des kurzen Sommers, das leuchtende Verfärben der steilen Berghänge über ihr, den herrlichen Indian Summer und dann wieder die Kälte und Nacht des langen west-kanadischen Winters.
Vielfältiges Leben hatte sich um sie herum ausgebreitet. Vorbeiziehende Elche hatten mit Schaufeln und Schultern ihre unteren Äste berührt, gestreifte Eichhörnchen in ihren Zweigen gespielt, Waldhühner in ihrem Dickicht Ruhe und Geborgenheit gefunden. Weißkopfseeadler waren achtlos über sie hinweggeflogen, aber einmal hatte sich auch der eher seltene Fischadler auf ihrer Spitze ausgeruht. Schwarzbären hatten die saueren Beeren der sie umgebenden Schneeballensträucher genascht, und so mancher Grizzly sein juckendes Fell an ihrem Stamm gescheuert. Die abgenagte Rinde der Laubholzbüsche um sie herum zeugte vom eifrigen Nahrungssuchen der Stachelschweine. Im Fluss waren Tausende und Abertausende von Äschen und Regenbogenforellen auf dem Weg zum Ablaichen an ihr vorübergezogen.
Werden und Vergehen hatte sie gesehen, und dann war der Tod schließlich auch zu ihr selbst gekommen.
Ihr Sterben vollzog sich langsam und zunächst kaum wahrnehmbar. Was kam zuerst? Das Ausfallen der Nadeln und Dürrewerden an der Spitze oder das Kraftloserwerden, nicht mehr voll Versorgen-Können und langsam Loslassen-Müssen der Wurzeln?! – Jedenfalls neigte sie sich allmählich immer mehr zur Seite,
dabei kahler und trockener werdend, bis sie – einer Absperrbarriere gleich – nahezu waagrecht über dem Wasserspiegel hing. Ein heftiger Herbststurm brachte sie schließlich gänzlich zu Fall und sie blieb – von der Strömung ein wenig abgetrieben – im seichten Uferwasser liegen. Hitze und Frost, Eis und Schnee, Wasser und Bewegung, Verwitterung und Fäulnis arbeiteten daran Jahr um Jahr. Wurzeln, Zweige und Äste brachen ab, wurden abgerissen, abgerieben, fielen ab, trieben davon.
Der untere Teil eines mittleren Wurzeltriebes samt seinen Abzweigungen und Saugwurzelansätzen wurde von der Flut weggetragen und blieb an einem Felsen unter einem Gewirr von anderem Treibholz hängen. Mehrere Jahre verbrachte er so – Wasser, Wetter, Wind und wechselnden Temperaturen ausgesetzt – bis ihn die Flutwelle eines neuen Frühjahres frei spülte und den Fluss entlang mitnahm. Wer weiß, wie lange er dann dort oder im angrenzenden See verbracht hat? – Wer weiß, wie er wieder in die Strömung des Flusslaufs gefunden hat und schließlich an jene Stelle in der friedlichen Bucht des unteren Kathleen-Sees geschwemmt wurde, wo er als das Yukon-Holz schließlich von mir gefunden und als solches bezeichnet wurde?

In meine Hand
In meine Hand gelangte das Yukon-Holz exakt am 12. September des Jahres 2000. Seit zehn Tagen war ich nun schon in meinem Traumland. Von Jugend an hatte ich vom Norden des amerikanischen Kontinents geträumt, von seinen Landschaften, seinen Bergen und Weiten, von Wäldern, Seen und Flüssen, von seinen Tieren und Menschen, von Indianern und Trappern, von ihren Blockhütten und Zelten. Und nun war ich tatsächlich selbst dort, konnte die erträumte Wirklichkeit mit eigenen Augen sehen, – und sie war schöner und gewaltiger als in allen meinen kühnsten Träumen.
Adler, Elch und Schneeziege hatte ich als begeisterter Naturliebhaber in den vergangenen Tagen schon gesehen, Rotlachs, Äsche, Regenbogenforelle und Namaycush als enthusiastischer Fliegenfischer bereits gehakt und gefangen.
Und gerade wegen der letzteren, der mit amerikanischer Bezeichnung „Lake trout“ und mit indianischem Namen „Namaycush“ genannten, herrlich gezeichneten Seesaiblinge, war ich heute noch einmal in Begleitung meines Guides und Freundes Lonnie hier. Ihre Färbung und Zeichnung, grauschwarz mit nahezu makellos weißen Tupfen auf der Oberseite, silbergrau oder auch – wohl je nach Ernährungsweise – hell orange leuchtend ihr Leib und die Bauchflossen, ihre Größe und Kampfkraft, dazu die Tatsache, dass sie mit der Fliege nur schwer, nur mit dem richtigen Fachwissen und der exakten Technik an den Haken zu bringen waren – all das hatte es mir einfach angetan!
Lonnie hatte mich am ersten Tag am Lower Kathleen darin eingewiesen, hatte mir zunächst vom Boot aus die Stellen im klaren Wasser gezeigt, an denen die begehrten Namaycush zu viert, sechst oder acht in kleinen Trupps auf der Suche nach Nahrung rudelnd vorbeizogen, hatte mir dann demonstriert, in welchem Winkel die relativ große Nassfliege gegen die Strömung, die der Kathleen River auch im See hier noch behauptet, auszuwerfen war, in welcher Tiefe sie driften musste, um keine Hänger zu produzieren, wie ich die Schnur danach zu straffen und mit kurzen Rucken einzuholen hatte, welcher Bogen dabei zu beachten war, damit sich schließlich der ersehnte Kontakt einstellen konnte. – Und obwohl ich eigentlich von Herzen überzeugter Trockenfliegenfischer bin und deshalb am ersten Tag dort auch nach dem Fang zweier „Lake-trouts“ mit dem Nassfischen aufhörte, um mich dann lieber mit Rehhaar-Segdes den Äschen und vor allem den wild kämpfenden Regenbogenforellen zu widmen, war ich begeistert und fasziniert von der Waid auf die für mich bis dahin unbekannten und deshalb auch ein wenig exotisch anmutenden „Namaycush“.
An diesem erwähnten zweiten Fischtag hatte Lonnie ohne große Mühe bereits vier stattliche Exemplare gefangen, während ich bisher immer noch nicht nur „Schneider“ hieß, sondern es auch war. Natürlich hatte ich versucht, alles richtig zu machen, und mir Mühe gegeben, aber es war alles umsonst gewesen!
Herrlich anzusehen war zwar das Panorama mit dem See vor mir und dem bewaldeten Ufer gegenüber, mit den in der Ferne emporsteigenden Bergen, dem Weißkopfseeadler, der sich schier mühelos immer höher und höher in den blauen Himmel schraubte, dem buntgefärbten Cooper Hawk, der einen Moment lang rüttelnd über unserem Ufer stand, den beiden Whiskey Jacks, die im Wipfel einer Black Pine miteinander stritten, und dem schwarz-weiß-blau gefärbten Kingfisher, der sich wieder und wieder vom Ast eines gegenüberstehenden Baumes mit so viel mehr Fangerfolg in die Fluten stürzte, als ich ihn zu verzeichnen hatte. Denn noch immer hatte ich nichts gefangen!
Um einer weiteren Frustration meinerseits vorzubeugen machte Lonnie den vernünftigen Vorschlag, zuerst einmal eine Teepause einzulegen. Ruhe und Konzentration sollte ich zurückgewinnen. Doch obwohl mir die Unterbrechung sicherlich gut tat – an meinem Fangergebnis änderte sich zunächst weiterhin nichts.
Noch einmal – zum wievielten Male eigentlich? – zeigte mir mein unermüdlicher Guide das Auswerfen, Absinkenlassen, Einholen von Schnur und Köder – mit dem einzigen Erfolg, dass er dabei seinen 5. Fisch fing. – Dieser Fang sollte sich allerdings auch für mich als bedeutsam herausstellen. Nicht nur deshalb, weil es dann endlich auch bei mir klappte und ich endlich, endlich im wahrsten Sinne des Wortes „den Bogen raus“ hatte, also endlich richtig auswarf, einzog und anschlug, nun nicht mehr nur den „bottom“ und damit den Yukon selbst gehakt hatte und nach dem heißersehnten Ruck dieses Mal starkes, ziehendes, pochendes Leben am Ende meiner Angelschnur spürte, was ich danach dann gleich noch weitere vier glückliche Male erleben durfte, sondern weil jener fünfte Fang Lonnies mir nämlich völlig unverhofft mein Yukon-Holz bescherte.
Wir hatten kurz zuvor beschlossen, diesen zuletzt gefangenen Fisch zum Hauptbestandteil unseres Mittagslunches zu machen – während wir sonst üblicherweise „catch and release“ praktizierten. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone in Folie gewickelt, sollten seine orangeroten Filets uns, im Campfeuer saftig blassrosa gegart, mit Brot und Bier köstlich munden.
Das Abschlagen des Fisches besorgte Lonnie übrigens mit einem Stück Holz, das er am Ufer wahllos vor sich vom Boden aufgegriffen hatte, um es nach getaner Arbeit wieder achtlos dorthin zurückzuwerfen. Zufällig fiel mein Blick auf jenes aufs Geradewohl ergriffene Werkzeug und – beeindruckt von seiner Form und seinem Aussehen – hob ich es auf und betrachtete es näher: welch eigenwilliges Gewächs mit Verdickungen, Verjüngungen, Höckern, Vertiefungen, Abspreizungen, Augenknöpfen, Spalten und Rissen hielt ich da in der Hand! Ein wahrhaft seltenes und seltsames, merkwürdiges und bemerkenswertes Gebilde!
Fast automatisch schloss sich meine rechte Hand um den sich verjüngenden Teil, wobei meine Finger sich nahezu passgenau in dessen Mulden und Ausbuchtungen hineinschmiegten, während die linke sich unwillkürlich um den ausladenderen, dickeren Teil am anderen Ende schloss, seine glatte Oberfläche und seine abgeschliffenen Rundungen mit einer fast liebkosenden Bewegung umfassend. Genau so halte ich das Yukon-Holz auch heute noch, wenn ich es von seinem neuen Ruheplatz auf meinem Schreibtisch auf- und an mich nehme. Und jedes Mal spüre ich die Ruhe und Wärme, die von ihm ausgeht und sich gleichermaßen in mir, meinem Denken und Empfinden ausbreitet. Jedes Mal ist mir dabei, als halte ich damit gleichermaßen den ganzen Yukon in meiner Hand, und das, was ich dort erlebt und gesehen habe, kommt mir augenblicklich wieder in den Sinn.

Schon auf der Hinreise hatte ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich wohl als Erinnerungsstück aus meinem Traumland mit nach Hause nehmen könnte: einen wertvollen Nugget etwa, ein Stück Elchgeweih, eine prächtige Fischtrophäe oder auch nur einen einfachen aber markanten Stein – als ich dann dieses Stück Holz in Händen hielt, wusste ich sofort: „Das und nichts anderes ist mein Yukon-Souvenir!“


Gesichter, Gestalten, Geschöpfe
Gesichter, Gestalten, Geschöpfe der Natur und der Fantasie, Gegenstände, ganze Landschaften und geologische Formationen zeigt das Yukon-Holz, je nachdem, wie man es dreht und wendet, stellt oder legt, in welchem Licht oder vor welchem Hintergrund man es betrachtet. Eine Fülle von Ansichten und Einsichten ergeben sich dabei. Sie alle regen an zum Nachdenken, Meditieren, Philosophieren.

Wie die Landmasse
Wie die Landmasse des Yukon selbst liegt das Holz vor mir: breit und ausladend, in seinem vorderen, verdickten Teil, einem großen Landrücken mit Weiten und Flächen, Senken und Erhebungen gleich, durchzogen von Fluss- und Bachläufen wie von Adern, dahingestreckt wie ein riesiger Gletscher mit all seinen Spalten und Rissen, gekrönt von schroffen, steilen aber auch sanft abgerundeten Berggipfeln.
Knopfaugenförmige Rundungen erinnern an Seen, Teiche und Tümpel. Senkrechte Abstürze lassen an Felswände und Abgründe denken. Nahezu konzentrische Kreise auf der Unterseite gleichen den Höhenlinien einer Landkarte.

Eis, Geröll, Wasser und Wind haben das Holz zu dieser Form abgeschliffen – genauso wie die Eiszeiten das Land geformt haben mit ihren urzeitlichen Kräften, Elementen und Gewalten. – Verborgen in seinem Innern, eingelagert in Gesteinschichten, in der Erde begraben, eingebettet in den Kies der Flüsse und Bäche liegt ein Schatz, der für viele Menschen den Yukon erst zum reichen und begehrenswerten Land gemacht hat: Gold! – Und so haben in den Jahren des großen Goldrausches von 1897 - 1899 Zehntausende das Land besucht, wenn nicht heimgesucht, um ihm Teile dieses Reichtums zu entreißen.
Davon, wie gründlich und mit welcher Rücksichtslosigkeit das damals geschah, erzählen Berichte und Fotografien aus jener Zeit. Auch heute noch reißen Maschinenungetüme auf der Suche nach dem vermeintlichen Reichtum kaum heilende Wunden in zuvor intakte Landschaften und Lebensräume. Wenn man, etwa im Tal des Klondike, die schier endlosen Ketten des auf der maschinellen Goldsuche zurückgeblieben Kiesschuttes betrachtet, erschrickt man darüber, mit welcher Gleichgültigkeit gegenüber der Natur der Mensch vorgeht, wenn es um seinen finanziellen Gewinn und wirtschaftlichen Profit geht.
Das hat Chief Seattle, Häuptling des Indianerstammes der Duwamish, vor knapp 150 Jahren schon erkannt und über den in die Natur seiner Heimat eindringenden weißen Mann geurteilt: „Wir wissen, dass der weiße Mann unsere Art nicht versteht. Ein Teil des Landes ist ihm gleich jedem anderen, denn er ist ein Fremder, der kommt in der Nacht und nimmt von der Erde, was immer er braucht. Die Erde ist sein Bruder nicht, sondern sein Feind, und wenn er sie erobert hat, schreitet er weiter... Er stiehlt die Erde von seinen Kindern – und kümmert sich nicht. Er behandelt seine Mutter, die Erde, und seinen Bruder, den Himmel, wie Dinge zum Kaufen und Plündern, zum Verkaufen wie Schafe oder glänzende Perlen.“
Dabei ist das unverdorbene und unverfälschte Zusammenspiel der Natur, ist die Weite, die Stille und unglaubliche Schönheit dieses kaum von Menschen besiedelten, ursprünglichen Landes, die Kühle seiner Schneegipfel, das tiefe Schweigen seiner unendlichen Wälder, die Klarheit der Flüsse und Seen, die Reinheit der Luft, das Farbenspiel des Nordlichts, seine Unberührtheit und Unversehrtheit das, was seinen eigentlichen Wert und unwiederbringlichen Reichtum ausmacht.
Für die meisten Menschen damals wie heute ist Gold der Inbegriff von Reichtum, Glück, Sicherheit und Geborgenheit. – Welcher Trugschluss das sein kann, erfuhren nicht nur die, denen der große Fund erst gar nicht gelang und die darüber hinaus noch das wenige verloren, was sie einst hatten, sondern auch die Glücklichen und Erfolgreichen, die in der Tat auf das heißbegehrte Erz stießen. Sie hatten oft nicht lange Zeit und Gelegenheit, sich ihres Glücks zu freuen, sondern mussten mit dem Neid, der Gier, dem Hass, der Verschlagenheit, gar der Mordlust anderer rechnen und kämpfen – ein Kampf, den viele verloren.
Vom Gold allein geht nicht einfach das Glück des Lebens aus. Um wirklich glücklich zu sein und das Grundgefühl der Geborgenheit im Leben zu entwickeln, braucht der Mensch ungleich viel mehr, nämlich einen Sinn, eine Aufgabe, einen Glauben und eine Hoffnung, braucht er Anerkennung, Liebe, Gemeinschaft und Freundschaft.
Gold allein kann das nicht leisten und vermitteln, es kann höchstens die materiellen Grundlagen dazu sichern und erweiterte Lebensmöglichkeiten erschließen.
Gold an sich ist – nüchtern betrachtet – ein Metall, das ein wesentlich höheres spezifisches Gewicht als andere hat, das weder im Wasser noch an der Luft oxydiert, so dass es immer glänzt, gleich, wo man es findet – ob als Ader in einer Felswand, als tropfenförmige Gebilde in den Wurzeln eines Baumes hängend oder als Nugget und Staub im Kiesbett eines Gewässers. Diese Eigenschaften und sein relativ seltenes Vorkommen machen es wertvoll, und es ist hervorragend geeignet, als Bemessungsgrundlage für andere Werte zu dienen. Völlig unbrauchbar, seiner Weichheit wegen, ist es dagegen bei der Herstellung von Gebrauchsgegenständen wie Waffen, Werkzeugen oder Angelhaken. So wurde es in erster Linie Zahlungsmittel und Basismaterial der Schmuckerzeugung. Was das Gold wirklich wertvoll und kostbar macht, ist seine ideelle Einschätzung durch den Menschen. Und so liegt die Besonderheit des Nuggets, den ich meiner Frau mit nach Hause brachte, auch nicht in seinem Dollar-Gegenwert, sondern darin, dass es ein Geschenk der Liebe ist. Sicher hätte es seinen ideellen Wert noch gesteigert, wenn ich das kleine Goldklümpchen irgendwo selbst gefunden hätte – man hat ja heutzutage auch als Tourist die Möglichkeit, in speziell dafür abgesteckten Claims zu schürfen – aber die Zeit, die ich dafür hätte aufwenden müssen, wäre mir viel zu schade gewesen, angesichts der Möglichkeit, stattdessen zum Fischen zu gehen, die Natur zu beobachten oder auch nur da zu sein und in ihre Stille hineinzulauschen. Wenn Mitte bis Ende September der Indian Summer die Blätter der Zitter- und Balsampappeln überall im Land leuchtend gelb bis satt orange färbt, wenn die Luft von diesen Farben nur so flimmert, dann sehe ich mein Gold im Yukon und das in einer unvergleichlich überwältigenden, verschwenderischen Fülle und Pracht.


Tiere
Tiere vor allem sind und waren es, die mich mit so großem Verlangen in den Yukon gezogen haben, und er hat mich diesbezüglich nicht enttäuscht. Was habe ich nicht schon alles während meines ersten Aufenthaltes dort gesehen und wahrgenommen: den trillernden Ruf des Eistauchers über dem Wasser, die rauschenden Schwingen der Tundraschwäne, das Rudel Schneeziegen, das als weißes Einsprengsel im Bunt der Bergmatten steht, den Elchbullen, der kraftvoll aber ohne Eile unseren Weg kreuzt, die Elchkuh, die mit ihrem Kalb ruhig und gelassen am Flussufer steht, das Waldhuhn, das vertrauensvoll auf seinem Fichtenast sitzen bleibt, das gestreifte Eichhörnchen, das mich als Eindringling keckernd beschimpft, den Coyoten, der ohne Scheu den Weg entlang streift, den Schwarzbären, der plötzlich am anderen Flussufer durch das Dickicht bricht und mir Bewunderung und Furcht zugleich einflößt, den Weißkopfseeadler, der sich majestätisch von seinem Ruheplatz auf dem Tannenwipfel in die Lüfte erhebt, das große Wapiti-Hirsch-Rudel, das friedlich am Straßenrand grast, die Forelle, die sich mit kräftigem Schwanzschlag aus dem Wasser schnellt, die Äsche, die im klaren Kolk aufsteigt und die Fliege von der Wasseroberfläche nimmt, die Rotlachse, die sich zum Laichen im Bach versammeln, den Zug der Kanada-Gänse am Himmel, den Formationsflug Gänsesäger über dem Flusslauf, die um die Baumwipfel schwirrende Schar der behelmten Wax-Wings, den Whiskey-Jack, der in langem Gleitflug meinen Angelfluss überquert – einmalige Eindrücke dieses zum Glück so tierreichen und dafür so menschenarmen Landes!

Grizzly, Wolf, Karibou, Dall-Schaf, Biber, Fischotter und Stachelschwein stehen noch auf der Beobachtungswunschliste, aber ich bin sicher, weitere Yukonreisen werden mir auch deren Anblick noch bescheren.Tiere in freier Wildbahn, in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen und zu beobachten, - was gibt es Schöneres?! Ich jedenfalls liebe es, und brauche es zu meinem Glück. Ich denke, Häuptling Seattle hat recht, wenn er sagt:
„Was ist der Mensch ohne die Tiere? Wären die Tiere fort, so stürbe der Mensch an großer Einsamkeit des Geistes!“
Schon während meiner Kinder- und Jugendzeit hat mich das Erleben der Natur geprägt, das Erlebnis „draußen“ zu sein, draußen in Feld und Wald, an Bach, Tümpel und Teich. Schon damals waren es die Wildtiere, die mich faszinierten und anzogen. Gegen Ende des letzten Krieges geboren, war ich zu Beginn der 50er Jahre gerade mal ein Knirps von 6 Jahren, der mit seinen nur unwesentlich älteren Spielkameraden anfing, die heimatlichen Feld- und Waldfluren zu durchstreifen. Wir waren zu dieser Zeit nicht gerade mit Spielsachen und Spielmöglichkeiten überhäuft. Öffentliche Spielplätze waren noch so gut wie unbekannt, die “Segnungen“ des Fernsehens gab es noch nicht oder waren zumindest für das tägliche Leben noch ohne Bedeutung. Und so blieb uns zum Spielen und zum Zeitvertreib eigentlich nur die Straße, die „Gass“, wie wir sagten, und wenn wir davon noch von tatsächlich ruhegestörten oder auch nur schlicht verständnislosen Erwachsenen vertrieben worden waren, der Wald und das Feld. Im Grunde genommen genügten sie uns auch vollkommen, denn sie boten uns alles, was wir brauchten: Raum und Ungestörtheit, Versteck und Unterschlupf, Material zum Bau von Hütten und zum Anfertigen unserer „Waffen“, sowie die Mahlzeiten für den Zwischenhunger in Form dessen, was wir uns von Äckern und Gärten per Mundraub stibitzten. Hier waren wir zu Hause. Hier kannten wir uns aus. Wir wussten, wo die ersten Schlüsselblumen blühten und wo man für den Muttertag Maiglöckchen pflücken konnte. Wir wussten, wie viele Rehe im Revier standen, welcher Fuchsbau befahren war und welcher nicht, in welchen Baumkronen die Bussarde ihre Horste hatten und welches die Schlafbäume der Fasanen waren. Gar manchen Nachmittag haben wir dort draußen verbracht mit Indianerkampf oder auf der Jagd nach den Eidechsen am Bahndamm und den Molchen und Fröschen in den Bombentrichtern des vergangenen Krieges. Kamen wir abends abgerissen, schmutzig, müde aber glücklich nach Hause und hatten das gemeinsame Abendessen samt dem elterlichen Donnerwetter wegen des zu langen Ausbleibens, einer zerrissenen Hose oder vernachlässigter Pflichten für Haus und Schule hinter uns, wurde der am Tag gestillte Erlebnishunger durch die Lektüre von Tier- und Abenteuerbüchern schon wieder neu entfacht. In jenen frühen Jahren war es gerade die bereits in den 30er-Jahren von Erich Kloss geschriebene und von Moritz Pathé mit eindrucksvollen Federzeichnungen illustrierte Geschichte eines Jungen, der die Jahreszeiten in einem Forsthaus verbringt, die Tiere des Reviers beobachtet, dabei manches Abenteuer erlebt und schließlich seine Ausbildung zum Förster erfährt, die mich in ihren Bann zog und in mir den Wunsch erweckte, selbst einmal Förster zu werden. Ich erinnere mich noch gut, wie ich damals oft – meinem literarischen Vorbild folgend – mit einem zwar sehr einfachen, nahezu nutz- und wertlosen Fernglas um den Hals, das ich aber dennoch stolz als meinen wertvollsten Besitz trug, hinaus in den Wald zu meinen Pirschgängen zog.
Dieser Angewohnheit blieb ich auch in späteren Jahren noch treu, nur dass ich dann eben in die Rollen anderer Buch- und Romanhelden schlüpfte. Die Indianer und Bleichgesichter eines Karl May mussten dafür ebenso herhalten wie die Abenteuergestalten Jack Londons oder die Siedler, Eingeborenen, Forscher und Biologen aus den Büchern von Allen Roy Evans und Fred Bodsworth. Es konnte auch vorkommen, dass ich als rotröckiger RCMP-Polizist oder als patrouillierender Nationalparkwächter meine Streifen zog. Da ich mit Vorliebe Expeditionsberichte las, „führte“ ich auch manchmal fiktive Expeditionen durch „unser“ Revier und war stolz, wenn ich meinen ja nur eingebildeten Pirschgästen recht viel Wild zeigen konnte. Dabei kam es häufig zu merkwürdigen Verwandlungen, wurde doch aus einem Sprung Rehe mit einem Male eine Herde Karibous, aus einem Fuchs ein Wolf und aus einem harmlosen Feldhasen urplötzlich ein reißender Grizzly.
Auch wenn ich als Erwachsener die Dinge jetzt natürlich nüchtern und realistisch betrachte, habe ich mir doch die Liebe zu Tier- und Naturbeobachtungen ebenso bewahrt, wie ich die Romantik schätze, die von der Vorbereitung und Durchführung solcher Unternehmungen ausgeht. Noch heute lacht meine Frau über die Berge von Ausrüstungsgegenständen, die sich am Vorabend eines Angelausfluges in unserer Eingangsdiele auftürmen, und kann sich dann meist in Anspielung auf eine bekannte Fernsehserie die Bemerkung nicht verkneifen: „Aha, wieder mal: Expeditionen ins Tierreich!“
Das Ziel meiner Reise- und Erlebnissehnsucht war ursprünglich gar nicht der hohe Norden gewesen. In unserer Bubenzeit übte eigentlich Afrika, der schwarze Kontinent, den größten Anreiz auf unsere Abenteuerlust und unser Fernweh aus. Ausgelöst wurde dies vor allem durch ein schön gestaltetes Album, das man für damals beachtliche DM 2,- erwerben und in das man genau 100 wunderschön bunte Bilder einkleben konnte, die es beim Kauf einer bestimmten Margarinesorte im Lebensmittelgeschäft dann gratis gab. Am meisten gefragt waren bei uns natürlich die Tierbilder unter ihnen mit Darstellungen von Löwen, Elefanten, Giraffen usw. „Safari in Afrika“ – das war damals unser aller unerreichbarer und unerfüllbarer Traum.
Im Laufe der Jahre jedoch verlagerten sich meine Traumziele immer mehr in den Norden unserer Erde. Immer stärker wurde für mich die Faszination, die von der dortigen Fauna und Flora ausgeht, – vielleicht deshalb, weil sie der heimischen ähnlicher und verwandter ist, nur eben großartiger und gewaltiger, vielfältiger und schöner, dazu ursprünglicher und unverdorbener, mit Tierarten, die bei uns zwar auch einst heimisch waren, aber längst ausgerottet und ausgestorben sind.
Besonders Bär und Elch hatten und haben es mir angetan. War es früher mehr der Grizzly gewesen, der aufgrund seiner majestätischen Größe, seiner unglaublichen Kraft und Schnelligkeit und seiner Unbezwingbarkeit ganz oben auf der Liste meiner Lieblingstiere stand, so verdrängte ihn immer mehr der Elch als Sinnbild von Majestät, Souveränität und Stärke.
Welch einen herrlichen Anblick bietet doch solch ein Elchbulle, wenn er seinen massigen, schwarz-blau-braun gefärbten Körper auf weißschimmernden Läufen etwas staksig, aber doch mit großer Trittsicherheit durch das Unterholz bewegt oder den mächtigen, mit einem weitausladenden Schaufelgeweih ausgestatteten Schädel mit der charakteristischen, scheinbar etwas zu lang geratenen Nasenschnauze und dem voluminös vom Unterkiefer herabhängenden Zottelsack bedächtig zum Wasserschöpfen neigt – in der Tat: der König der Wälder!

So oder so ähnlich habe ich ihn auch immer wieder in einer Vielzahl von Aquarellen und Pastellkreidezeichnungen darzustellen versucht.
Beide Tiere, sowohl Elch als auch Bär, schienen mir für den Überlebenskampf in der nördlichen Wildnis am besten ausgestattet und geeignet.Vielleicht stammt meine Vorliebe für den Norden und seine Bewohner ja gerade auch daher, dass mich der Überlebenskampf von Mensch und Tier unter den harten, arktischen Bedingungen so faszinierte, und vielleicht auch, weil diese Landschaft den bestpassendsten Rahmen für ein von mir insgeheim ersehntes Waldläuferleben abzugeben vermag.
Ganz sicher spielte dann in späteren Jahren auch die Fischerei eine Rolle. Unter all den Tieren, mit denen ich während meiner Kinder- und Jugendzeit „Kontakt“ hatte, kamen Fische nur selten vor. Wir fingen zwar ab und zu in Bächen und Gräben Stichlinge und in jedem Frühjahr die Schleien, die aus dem Mühlenteich über das Wehr in den für sie viel zu flachen Bach gelangten, so dass wir sie leicht mit der Hand „grapschen“ konnten, um sie anschließend wieder in den Teich zurückzusetzen, ansonsten aber hatten wir kaum Berührungspunkte mit den Geschuppten. Große, fischreiche Gewässer gab es in unserer Umgebung nicht, und für Aquarienhaltung hatten wir weder das nötige Geld noch das Interesse. Dieses wurde erst geweckt, als ich viele Jahre später – bereits als Erwachsener – zum Angeln kam. Zwar hatte mich schon immer das Bild des Mannes beeindruckt, der am Wasser stehend oder sitzend versucht, mittels Rute, Schnur, Schwimmer, Haken und Köder die Ungewissheit unter Wasser zur Gewissheit über Wasser zu machen. Für mich persönlich sah ich aber nie eine richtige Möglichkeit dazu. Ich wusste nicht wie, wo und womit ich angeln sollte, bis mich dann erfahrene Zunftkollegen doch in das Handwerk der Fischwaid einführten.

Zunächst an Baggerseen und künstlich angelegten Teichen, dann an natürlichen Gewässern wie Seen und Flüssen übte ich im Laufe der Zeit die Angelei mit all den bei uns gebräuchlichen Angelmethoden aus, wobei mir das Spinnfischen die liebste Art war, bewegt man sich doch dabei frei am Fluss entlang, ohne großen Ballast mit sich zu schleppen, nur mit der Rute und den allernötigsten Utensilien bewaffnet von einer guten Stelle zur anderen, hat es ausschließlich auf die Räuber unter den Fischen abgesehen und kann sich zudem einer interessanten Technik erfreuen.
Von der Hochschätzung des Spinnfischens hin zum Verlieben ins Fliegenfischen war es dann nicht mehr weit – und heute, nach über 10 Jahren des Lernens und Liebgewinnens, des Leidens und Verzweifelns, des Erfolges und der Rückschritte, des immer weiteren Lernens und Dazugewinnens bin ich dieser Leidenschaft – besonders der des Trockenfliegenfischens – einfach rest- und hoffnungslos verfallen. Aufgrund dieser Tatsache ist es einleuchtend, dass ein Traumland für mich nur da liegen konnte, wo es die Möglichkeit gab, dieser Passion zu frönen.
In der Addition mit den anderen, oben erwähnten Kriterien, die für die Auswahl meines Traumzieles entscheidend waren, hieß dieses Land für mich zunächst stets „Alaska“. Hier glaubte ich, all das vereint vorfinden zu können, was ich schon immer gesucht habe und an dem mein Herz bis heute hängt: wilde, ursprüngliche Landschaft, großartige Tierbeobachtungen, traumhaftes Fliegenfischen, Weite und Lebensraum.
Dass ein solches Traumland nicht nur in Alaska, sondern gerade und erst recht im Yukon zu finden ist, erfuhr ich erst nach intensiver Vorbereitung mit Hilfe von Literatur, Videos und Gesprächen mit entsprechenden Reiseveranstaltern. Das Ergebnis am Ende war, dass ich mit Sicherheit wusste: hier war und ist „mein“ Land, „meine“ Tierwelt, „mein“ Fischerparadies!
Wenn man – so wie ich – gleichsam in einem Atemzug von Tierliebe und Fischfang spricht, muss man sich zwangsläufig die Frage gefallen lassen, wie das beides zusammenpasst und welches Verhältnis man tatsächlich zu den Tieren hat.
„Die Rehe, das Pferd, der große Adler –

sind unsere Brüder. . .
Der weiße Mann muss die Tiere behandeln
wie seine Brüder.
Ich bin ein Wilder und verstehe es nicht
anders.
Ich habe tausend verrottende
Büffel gesehen,
vom weißen Mann zurückgelassen
– erschossen aus einem
vorüberfahrenden Zug.
Ich bin ein Wilder und kann nicht verstehen,
wie das qualmende Eisenpferd wichtiger
sein soll als der Büffel, den wir nur töten,
um am Leben zu bleiben.
Was immer den Tieren geschieht, geschieht
bald auch den Menschen.“
Häuptling Seattle
Bewunderungswürdig, schlichtweg bewunderungswürdig ist meiner Ansicht nach eine solche Haltung und Einstellung gegenüber der Natur und den Tieren. Welch ein Schöpfungsbild, welch tiefe Einsicht in die Zusammenhänge des Lebens spricht aus solchen Worten! – Anders als in den alttestamentlichen Schöpfungsberichten wird der Mensch hier nicht von vorneherein als der verstanden, der über die Tiere herrschen soll, sondern wird gesehen als Bruder und Schwester, das heißt, als gleich geschöpflicher, gleich lebensberechtigter Partner und Teil, hineingehörend in den großen Rahmen all des Geschaffenen, wohl wissend: was dem Bruder und der Schwester geschieht, geschieht auch mir, betrifft auch mich unmittelbar.
Und doch jagt der Indianer Tiere, tötet seine Brüder und Schwestern. Er tut es mit vollem Bewusstsein, den Schmerz um ihren Tod, die dadurch entstandene Lücke sehr wohl empfindend, das von ihnen dargebrachte Opfer dabei ehrend und würdigend. Er tut es, weil er es zu seinem Leben und Überleben braucht. Er weiß: es geht nicht anders! Deshalb bittet er auch das zu jagende Tier vorher und das erlegte hinterher um Verzeihung. Viele Riten und Kulte der sogenannten „first nation people“ erzählen davon. Er schätzt und achtet das Tier vor und nach der Jagd und lässt darum auch nichts von dem notwendigerweise getöteten Wild achtlos zurück, sondern gebraucht alles: das Fleisch, die Innereien, das Fell, die Knochen und Sehnen, sei es für seine Ernährung oder zur Herstellung von Kleidung, Zelten, Decken, Waffen und Gerätschaften. Auch wenn der Naturmensch das Tier verfolgt und tötet, bewahrt er sich ein liebevolles, familiäres, ja fast religiös scheues Verhältnis zu ihm.
Häuptling Seatlle, dessen Gedankengut und Gefühlswelt ich hier wieder- und weitergebe, bezeichnet sich selbst trotz solch edler Gesinnung in aller Bescheidenheit als „Wilder“, der nichts versteht. – Wie aber steht es da mit uns, die wir ja keine „Wilden“ sind und sein wollen, sondern uns für aufgeklärte, gebildete, hochtechnisierte und hochzivilisierte Menschen halten?! Nehmen auch wir noch so eine ehrfürchtige und verantwortungsvolle Haltung gegenüber dem Tier ein?! – Als ein schwaches, weil mehr oder minder formal gewordenes Relikt aus Zeiten solchen Denkens könnte man heute noch den Jägerbrauch der „letzten Äsung“ werten, die dem erlegten Wild, sozusagen als letzte Ehre, einen allerletzten, grünen Bissen in den Fang steckt, obwohl hier ja die absolute Notwendigkeit des Tötens von vorneherein gar nicht gegeben ist.

Im Allgemeinen aber ist unser Verhältnis zum Tier doch wohl eher als gestört, entfremdet, wenn nicht sogar pervertiert anzusehen. „Wieso“, wird man mir entgegenhalten,„lieben und füttern wir unsere Lieblinge etwa nicht mit großer Hingabe und Leidenschaft?!“ – Oh ja, das ist sicher richtig. Wir unterstützen dabei einen riesigen Zweig der Industrie und geben für die Ernährung und Gesundheit unserer Schoßtiere weit mehr aus, als wir je für Menschen in Hunger-Not- und Katastrophengebieten aufwenden würden. Wir lieben unsere Tiere, vor allem da, wo wir sie im Griff haben, und sie sich so verhalten, wie wir es wünschen. Wir haben sie am liebsten dort, wo sie unserer Meinung nach hingehören: auf dem Schoß, im Käfig, in ihrer Box, in dem Bezirk, den wir ihnen zuteilen in Haus und Garten. Wir lieben unsere Tiere, halten sie aber auch gerne auf Distanz, sehen sie am liebsten im Zoo, im Wildreservat und im Tierfilm. Tiere dagegen, die sich unserer Kontrolle entziehen und plötzlich und unerwartet auftauchen, wo wir sie nicht vermuten, flößen uns eher Angst und Schrecken ein, so wie etwa Spinnen und Mäuse, ganz zu schweigen von Ratten und Schlangen.
In der Kino- und TV-Unterhaltungsbranche haben Tiere seit langem ihren festen Platz: zum einen als niedlich vermenschlichte Märchen- und Fabelwesen oder als unberechenbare, grausam blutrünstige Monster. Und unsere Kinder, für die Kühe mittlerweile selbstverständlich lila sind und für die die Milch aus der Fabrik kommt, kennen all die Namen dieser TV-Tierhelden, während ihnen die Namen der einheimischen Singvogelwelt eher wie Fremdwörter vorkommen. Bei uns begegnet eine oft weit über das Maß hinaus schießende und deshalb auch mit recht zu hinterfragende Tierliebe einer erschreckenden Gleichgültigkeit, wenn es nämlich um unsere Lebens- und Essgewohnheiten geht, um unsere Gesunderhaltung etwa oder um unseren immensen Fleischkonsum. So werden Tierversuche für die Pharma- und Kosmetikindustrie, Massentierhaltung, quälende Schlachttiertransporte, fast uneingeschränkte Schleppnetzfischerei und Massentiertötungen bei Verdacht auf Seuchen und Krankheiten wie BSE und MSK nahezu stillschweigend hingenommen. Das Gefühl, durch Massenproduktion und weltweiten Handel vor Mangel und Hunger nachhaltig geschützt zu sein, hat unser Empfinden hierfür weitgehend abgestumpft. Sicher tun wir auch sehr viel für Natur- und Umweltschutz, weisen Schutz- und Schongebiete für bedrohte Biotope, Schonzeiten und -maße, Jagd- und Fangbegrenzungen für bestimmte Tierarten aus, weil viele von uns mittlerweile eine Ahnung davon bekommen haben, wie notwendig das ökologische Gleichgewicht nicht nur für das Überleben von Fauna und Flora sondern auch der eigenen Spezies geworden ist.
Dass Tiere dem Menschen zu nutze sein, dass die Natur von ihm gebraucht werden muss, steht außer Frage. Doch, wo liegt die Grenze zwischen Brauchen und Verbrauchen, zwischen Nutzen und Ausnutzen, zwischen notwendigem Nehmen und raffgieriger Ausbeutung der Natur, ihrer Resoursen und ihrer Lebewesen? Wann und wo fing das eigentlich alles an?! Wann wurde der erste Schritt getan vom lebensnotwendigen, weil lebenserhaltenden Gebrauch hin zum eigentlich unnötigen, weil nur noch dem Profit verschriebenen Missbrauch der Natur?
Es begann, so denke ich, schon mit dem Trapperwesen. Denn anders als die Indianer fingen und töteten Trapper Pelztiere nicht mehr nur, weil deren Fell und Fleisch ihr Leben unmittelbar absicherten, sondern weil sie durch den Verkauf der Felle einen Überschuss erzielen konnten, der ihnen die Beschaffung dessen ermöglichte, was sie sonst zur Erhaltung ihres Lebens für erforderlich hielten: andere Lebensmittel, neue Fallen, Waffen, Munition, Genussmittel und dergleichen. Die Tiere, die sie töteten, waren also nicht mehr unmittelbare, sondern nur noch mittelbare Garanten ihres Überlebens und oft darüber hinaus sogar eines – wenn auch meist nur bescheidenen – Reichtums. Vollends in den Dienst der Kapital- und Profitgewinnung gestellt wurde ihr Gewerbe dann mit der Gründung der großen Pelzhandelsgesellschaften. Was am Ende einer solchen Entwicklung steht, zumal wenn sie sich mit menschlichem Übermut und Unverstand paart, das hat Häuptling Seattle bereits im vergangenen Jahrhundert vorausgesehen und vorausgesagt:
„Wenn die Büffel alle geschlachtet sind, die wilden Pferde gezähmt, die heimlichen Winkel des Waldes schwer vom Geruch vieler Menschen und der Anblick reifer Hügel geschändet von redenden Drähten, - wo ist das Dickicht – fort; wo der Adler – fort, und was bedeutet es, Lebewohl zu sagen dem schnellen Pony und der Jagd: das Ende des Lebens und der Beginn des Überlebens.“
Gemeint hat er damit: richtiges, volles, gesundes Leben wird dann nicht mehr möglich sein, nur noch das nackte, eben irgendwie Überleben, aber ohne seine frühere Bedeutung und Fülle, ohne seinen ehemaligen Reichtum und Glanz, denn

Seattle fährt fort: „...was gibt es schon im Leben, wenn man nicht den einsamen Schrei des Ziegenmelkers hören kann, oder das Gestreite der Frösche am Teich bei Nacht?... Die Luft ist kostbar für den roten Mann, denn alle Dinge teilen denselben Atem – das Tier, der Baum, der Mensch – sie alle teilen denselben Atem. – Der weiße Mann scheint die Luft, die er atmet, nicht zu bemerken, wie ein Mann, der seit vielen Tagen stirbt, ist er abgestumpft gegenüber dem Gestank.... Fahret fort Euer Bett zu verseuchen, und eines Nachts werdet Ihr im eigenen Abfall ersticken.“
Hat der kluge Indianerführer mit seinen vorausblickenden Worten aus einem längst vergangenen Jahrhundert nicht in nahezu furchteinflößender Weise Recht behalten?! Doch zurück aus der Vergangenheit und hinein in die so kassandrisch vorhergesehene Zukunft, die ja nichts anderes ist als unsere längst wahrgewordene Gegenwart! Zurück auch aus gesellschaftlichen und globalen Vorwürfen und Schuldzuweisungen im Allgemeinen und hinein in meine eigene, ganz persönliche Verantwortung, in mein eigenes ganz persönliches Verhalten der Natur und den Tieren gegenüber, gerade als Angler und Fliegenfischer, und damit hin zur Gretchenfrage: Wie hältst du es denn selbst mit der berühmten „Ehrfurcht vor dem Leben“? ! – In meinen frühen Anglerjahren, so muss ich offen gestehen, hatte ich recht wenig Verständnis für solche Bedenken und schob sie einfach beiseite. Das Fischen mit Wurm, Made und Köderfisch stand für mich – weil erfolgreich – außerhalb jeder Diskussion.
Im Laufe der Jahre allerdings wurde ich sensibler – auch jenen oft so unscheinbaren Geschöpfen gegenüber – und stieg um auf Mais oder Teig. Zuletzt fischte ich nur noch mit Kunst- und Spinnködern. Sie waren leichter bereitzuhalten, angenehmer zu handhaben, und waren eigentlich nur auf die einzusetzen, die ja als Räuber selbst auf sie hereinfallen wollten. Wenn Raubfische sie dann attackierten, war es eben deren eigene Schuld, weil sie ja selbst darauf aus waren, Beute machen zu wollen. Räuber zu überlisten, das schien mir moralisch vertretbarer, als harmlose Friedfische hereinzulegen. – Was für eine blödsinnige Logik und Rechtfertigungsweise!
Beim Fliegenfischen endlich angelangt, glaubte ich, jetzt die endgültig reine und moralisch absolut unbedenkliche Art des Fischens gefunden zu haben, fischte ich hier doch schon sehr bald widerhakenlos und dem Grundsatz „catch and release“ folgend. Hatte ich in früheren Tagen immer Beute machen müssen, um mir und anderen meine Erfolge zu beweisen, war ich mittlerweile längst zu der Erkenntnis gelangt, dass Fische nicht dazu da sind um zu zeigen, welch tolle und erfolgreiche Kerle wir Angler sind.
Heute ist es mir eine selbstverständliche Freude, Fische – mit nur ganz wenigen Ausnahmen – wieder in die Freiheit zu entlassen. Ich esse selbst gerne Fisch und bereite auch Freunden gerne eine schmackhafte Mahlzeit daraus zu. Trotzdem muss ich längst nicht jeden maßigen Fisch seinem Element entreißen und ihm den Garaus machen. Die Möglichkeit des „catch and release“ befreit mich davon, und sie ist es auch, die unsere Passion von der Jagd unterscheidet. Hat ein Jäger erst einmal den Finger „krumm“ gemacht, gibt es kein Zurück und meist kein Entrinnen mehr für seine Beute. Er muss töten, um seinen Jagdtrieb zu befriedigen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum ich mich nie ernstlich für die Jägerei interessiert habe. Gerne bin ich Jagdeinladungen gefolgt, weil sie mich immer nah an das ersehnte Wild führten, auch fieberte ich voll Leidenschaft mit, ob das vorher angesprochene Stück auch wirklich kam und gut zum Schuss stand, aber dann im Augenblick des Knallens und Fallens fühlte ich meistens nur noch eine große Traurigkeit in mir.
Wir Fischer haben es da besser und leichter. Wir können den gefangenen Fisch zurücksetzen und – wenn wir es verantwortungsvoll und behutsam tun – auch darauf hoffen, dass er dieses Abenteuer relativ unversehrt übersteht. Untersuchungen gerade der allerjüngsten Zeit geben allerdings Anlass zu fragen, ob das – bei aller Umsicht und Sorgfalt – auch wirklich immer gegeben ist. Ist das, was ich da mit „catch and release“ tue tatsächlich so unbedenklich, wie es mir erscheint. Wie wirkt sich solches Vorgehen auf das Schmerz- und Stressempfinden des gehakten Fisches aus? Was bewirkt es im Stoffwechsel seines Organismus? Hat er wirklich eine reelle Chance, die Prozedur des Drills, der Entnahme, des Hakenlösens und Zurücksetzens langfristig gesehen zu überstehen und zu überleben? – Fragen über Fragen tun sich hier auf, von denen wir keine hundertprozentig richtig zu beantworten vermögen, vor allem nicht die, ob ich als Mensch überhaupt das Recht habe, dieses Tier – just for fun – nur zu meinem Vergnügen also – dem allem auszusetzen und es in seiner Existenz zu gefährden. Ich kann ja nicht wie Häuptling Seattle oder einer seiner Indianerbrüder sagen: „Danke, Bruder Fisch, dass ich dich fangen durfte. Du erhältst mich und meine Familie am Leben!“ Ich bin ja versorgt auch ohne ihn, kann mich von anderen, gekauften oder mitgebrachten Lebensmitteln ernähren, bin nicht auf seinen Fang notwendigerweise angewiesen. Ich bin eigentlich nur da, um meiner Lust zu frönen. Die Frage ist: darf ich das?! – Denn, über eines bin ich mir völlig im klaren: wenn ich als Angeltourist in der wundervollen Naturlandschaft des Yukon stehe, dann gibt es weit und breit kein Lebewesen, das so unwichtig, so unwesentlich und so unangebracht in diesem Biotop ist wie ich. Diese Natur braucht mich nicht. Ich habe weder eine Funktion, noch eine Bedeutung, noch einen Sinn darin. Jedes kleinste Insekt ist mir hier an Bedeutung und Wichtigkeit voraus. Diese grandiose Landschaft wäre auch ohne mich genauso unfassbar schön, sicher sogar schöner! Das im Geheimen aufeinander abgestimmte Uhrwerk ihres Lebens liefe auch ohne mich präzise weiter, so wie schon Tausende und Abertausende von Jahren zuvor, nur besser und ungestörter. Die Natur ist vollkommen, der Mensch kann sie nicht verbessern, er kann sie höchstens verschlechtern!
Als was bin ich also dort, und was habe ich hier zu suchen?! – Ich bin ein Gast, und als solcher habe ich mich hier zu verhalten und zu bewegen. Ich bin ein Fremder, der wie jeder, der nur kurzzeitig in einem gut funktionierenden Haushalt weilt, darin keine wirkliche Funktion hat. Er darf nur schauen und staunend zusehen, sich für den Augenblick vielleicht ein wenig heimisch fühlen, darf aber nicht wirklich in das gewohnte Geschehen eingreifen oder gar Bestehendes umstoßen und so das vorhandene Gleichgewicht stören. Und genauso, wie er gekommen ist, hat er dann auch wieder „traceless“, ohne störende Spuren zu hinterlassen, zu gehen. in der einzigartigen Naturlandschaft des Yukon kam ich mir stets vor wie ein Zuschauer, der zufällig und unvermittelt in ein großes Orchester geraten ist, - ohne Instrument und Partitur, unfähig, auch nur einen einzigen passenden Ton der gewaltigen Sinfonie hinzuzufügen, die da gespielt wird. Mir blieb nur das ehrerbietige Bewundern und ungläubige Staunen.
Natürlich versuchen auch wir Außenstehenden, uns in solch einem Land und solch einer Umgebung selbst eine Funktion zu geben, sind wir schließlich doch als Angeltouristen hier. Und so befleißigen wir uns, mittels Rute, Rolle, Schnur und Fliege in dieses wundervolle Gefüge einzudringen, um auf diese Weise etwa in die Rolle eines seiner Jäger oder Räuber hineinzuschlüpfen. Und doch wissen wir zugleich: wir sind das nicht tatsächlich, wir haben deren Aufgabe nicht wirklich, wir spielen ihre Rolle nur, weil wir sie uns selbst geben und anmaßen. – Und doch ist es schön, dieses Spiel zu spielen, ein wenig, wenn auch oft genug dilettantisch, mitzutun und auf diese Weise dem Konzert der Natur aktiv beizuwohnen.

Was bedeuten nun all diese Erkenntnisse und Einsichten für meinen eigenen Umgang mit der Natur und ihren Kreaturen, ganz konkret für meine eigene Angelpraxis?! - Im Grunde genommen dürfte ich von daher nur noch Fischen, wenn eine unbedingte Notwendigkeit dazu besteht. Das aber ist – wie gesehen – eigentlich für mich nie der Fall. Selbst auf einem Tages- oder Mehrtagestrip in der Wildnis wäre sie nur im äußersten Notfall gegeben. Das heißt, nüchtern betrachtet: ich habe eigentlich gar kein Recht zu fischen! Dennoch ist da diese Passion, diese unbändige Lust dazu, in mir! Und selbstverständlich will und werde ich ihr auch weiterhin nachgehen und nachgeben. Wenn auch die Fische ganz gewiss nicht dazu da sind, die Begierden von uns Anglern zu befriedigen, so möchte ich mir doch die Lust am Werfen mit der Fliegenrute, am Servieren der Fliege, am Überlisten und Fangen des Schuppenwildes nicht nehmen lassen. Ich möchte sie sogar, wie das bei uns modernen Menschen fast immer der Fall ist, noch intensivieren, sie noch öfter und konzentrierter genießen. Deshalb reist man ja gerade zu solch reinen, naturbelassenen und eben darum umso fischreicheren Gewässern, um dort die Freuden des Fischens viel unverfälschter und weitaus gesteigerter zu erleben, als das in unseren Breiten möglich ist.
Wie aber lässt sich solche Genusssucht, zumal verbunden mit dem Wunsch, sie ins Optimale zu steigern, ernstlich vereinbaren mit Tierliebe und – vor allem – mit den vitalen Bedürfnissen der Fische?! – Durch bloßes „catch and release“ ist dieses Problem, wie schon erwähnt, wohl nicht zu lösen, da bei noch so vorsichtiger und schonender Umgangsweise Verletzungen, innere Schädigungen oder andere Beeinträchtigungen der Gedrillten nicht immer völlig auszuschließen sind.
Seit einiger Zeit versuche ich mir deshalb vorzustellen, wie es wäre, an einem schönen, steigfreudigen Angeltag etwa, an dem ich mein persönlich gesetztes Fanglimit bereits erreicht hätte oder einfach keinen Fisch mehr entnehmen wollte, nicht nur, wie gewohnt, widerhakenlos sondern ganz ohne Haken zu fischen. Vielleicht klingt das absurd und ein wenig verrückt, weil „Fischen ohne Haken“ ja wohl einen Widerspruch in sich selbst darstellt. Aber wären die Abstriche, die ich dabei zu machen hätte, wirklich so gravierend für mich? – Ein guter Teil dessen, was für mich Fliegenfischen ausmacht und was ich daran so liebe, bliebe mir ja doch: der Aufenthalt in einer herrlichen, natürlichen Flusslandschaft, das Erkennen und Anpirschen erfolgversprechender Fischstandplätze, die Wahl der richtigen, fängigen Fliege, die Freude an der Technik des Auswerfens und des möglichst punktgenauen Anbietens, die Spannung bei der Abdrift der Fliege, den Adrenalinstoß beim Steigen des Fisches und beim Annahme-Schwall, das Frohgefühl beim ruckartigen – in diesem Falle allerdings wohl nur sehr kurzen – Kontakt mit der anvisierten Beute. Hinzu käme die befriedigende Gewissheit, den zeitweiligen Kontrahenten ohne Schaden in seiner Freiheit belassen zu haben.
Natürlich hat diese Sache „ohne Haken“ nun aber doch einen solchen, nämlich für mich selbst, denn ich wüsste ja nie genau, was ich da beinahe gefangen hätte, wie groß, wie schwer und wie schön meine Beute wirklich gewesen wäre. Auch die Freuden des Drillens, das Spüren des schönen, schweren Widerstandes am anderen Ende der Schnur mit seinem Rucken und Stoßen, der Anblick der kreisförmig gebogenen Rute und der straff gespannten Leine würden mir sicherlich sehr fehlen. Zudem wäre für den Fisch ein vielfach provoziertes Steigen ohne die Möglichkeit echter Nahrungsaufnahme sicher mit einem ungesättigtem Energieverlust verbunden, was ja auch einer gewissen Beeinträchtigung seinerseits gleichkäme. Ich will diesen Gedanken jetzt aber nicht weiterspinnen, um nicht letztlich in den Ruf eines wirklichen Spinners zu geraten. Dennoch werde ich diese „hakenlose“ Methode bei nächster Gelegenheit einfach einmal ausprobieren. Ich bin gespannt, welche Eindrücke sie bei mir hinterlassen wird.
Menschen


Menschen spielten im Yukon-Gebiet gegenüber den Tieren schon immer eine nur untergeordnete Rolle. Die historische Forschung geht von einer Erstbesiedlung vor etwa rund 30.000 Jahren v. Chr. aus, die wohl weniger von Norden her über die sogenannte „Beringia“, einer Landbrücke, die damals – wie Archäologen vermuten – zwischen Asien und Amerika bestand und während einer zwischeneiszeitlichen Erwärmung durch das Ansteigen der Meere und die dadurch bedingte Überflutung wieder verschwand, vollzog, als von den im Süden angrenzenden Prärie- und Waldgebieten ausging.
Nomadisierende Wildtöter drangen auf ihrer Suche nach neuen und reicheren Jagdgründen immer weiter nach Norden vor und erreichten so Gegenden, die bislang ihrer subarktischen Bedingungen wegen für längere Zeiten im Jahr als lebensfeindlich galten und deswegen noch unbesiedelt waren. Durch die erstaunliche Anpassungsfähigkeit des homo sapiens, durch das Erlernen und Anwenden neuer Techniken wurde es schließlich einer durch strenge und brutale Auslese abgehärteten Rasse möglich, auch jene einst unwirtlichen Gebiete zu bevölkern.
Es waren Menschen, die es verstanden, mit dem extremen Jahreskreislauf der gewaltigen Natur zu leben und sich ihm anzupassen. Sie lernten, auf die Stimmen der Wildnis um sie herum zu hören, sie zu deuten und auf ihre Zeichen zu achten. Sie entwickelten Fähigkeiten, Geräte, Werkzeuge, Kleidung, Behausungen, Vorratswirtschaft und den Einsatz des Feuers, so dass ein Überleben auch in den kalten, eigentlich lebensfeindlichen Jahreszeiten gewährleistet war. Dabei entstand eine Lebensweise, die Natur und Tiere sehr wohl nutzte und benutzte, nie aber ausplünderte und zerstörte. Sie wussten: Vernichten wir die Quellen des Lebens, so vernichten wir uns selbst! – Es war nicht zuletzt ihr reicher Schatz an Erfahrung und Wissen, der sie am Leben erhielt.
Und schon immer gab es dabei Einzelne, Gestalten, Individuen, bei denen solches Wissen und solche Fähigkeiten weiter, ausgeprägter, intensiver und verfeinerter entwickelt waren als bei anderen, die deshalb aus der Menge der anderen herausragten, und – so wie Chief Seattle – mehr Überblick, Reichweite und Weitsicht besaßen: „Führer“, „Häuptlinge“, „Schamanen“, „Priester“, „Heiler“ nannte man sie. Übernatürliche Kräfte schrieb man ihnen zu, weil sie Dinge voraussehen und voraussagen konnten, die andere nicht erkannten, und weil sie in der Lage waren, körperliche und seelische Wunden und Krankheiten zu verbinden und zu heilen. Oft lag ihre Besonderheit nur in der Fähigkeit, die Zusammenhänge der Naturphänomene klarer zu erkennen, konsequentere Schlüsse daraus zu ziehen und Erfahrungen besser zu nutzen. Gewisse Heilungskräfte mögen sich damit gepaart haben. All das genügte, um ihnen eine von den normalen Menschen abgehobene Position einzuräumen und sie als Vermittler und Deuter sowohl der real vorfindbaren Wirklichkeit als auch einer daneben und darüber existierenden geistigen Welt anzusehen. Von ihrer Führung und Leitung, von ihrem Wissen und Können versprach man sich den Erhalt des eigenen Lebens ebenso wie das Überleben des ganzen Stammes. Man gestand ihnen deshalb gerne Entscheidungsgewalt, Machtausübung und Privilegien zu. Der verantwortungsvolle Stammes- oder Sippenführer wusste dabei, dass er seine Macht und Vorrechte ausschließlich zum Wohl der ihm Anvertrauten ausüben und gebrauchen durfte. „Herrschen“ bedeutete für ihn in erster Linie „verantwortlich zu sein“, dafür Sorge zu tragen, dass das Leben seiner ihm anbefohlenen Untertanen geschützt und bewahrt bleiben, ihr Überleben gesichert und mit Sinn, Glück und Geborgenheit bereichert werden konnte. Diese Verantwortlichkeit und Fürsorge zeichnete schon zur Zeit des biblischen Alten Testamentes den guten, gerechten König, den sogenannten „melech“ aus und unterschied ihn deutlich vom „moloch“, der die ihm wegen seiner überlegenen Fähigkeiten oder auch nur aufgrund ererbter Rechte zugestandenen Vorzüge und Machtbefugnisse wie einen Raub nur für sich selbst ansah und sie lediglich zum eigenen Vorteil und dem seiner ihm eigenen und ihm hörigen Gefolgschaft ausnutzte. So wurde aus dem verantwortungsvollen Führer der eigennützige und selbstsüchtige Verführer des Volkes. Mit großsprecherischen Worten und verheißungsvollen Versprechungen, mit beeindruckenden Gesten und publikumswirksamen Gebärden mobilisiert er die Massen und bringt sie auf Wege, an deren Ende nicht das Heil aller, sondern nur die Verwirklichung seiner eigenen Ziele und Interessen steht, Leid und Untergang der Menge dabei notfalls wohlkalkuliert einberechnend und billigend in Kauf nehmend. Auch diesen Typus des Verführers hat es schon immer gegeben. Besonders im gerade vergangenen Jahrhundert führte die Agitation solcher Machthaber zu den schrecklichsten Auswüchsen der Menschheit, wie die Kriege und Völkermorde dieser Epoche gezeigt haben. Dass es damit aber noch immer nicht zu Ende ist, beweisen die Rassenkonflikte und kriegerischen Auseinandersetzungen der jüngsten Vergangenheit bis in unsere Tage hinein. Und angesichts der raffinierten Produktwerbung unserer Tage kann die Frage, welchen Einfluss und Anteil an Führung und Verführung unsere heutige Konsum- und Genussgesellschaft auf uns alle ausübt und hat, wohl jeder von uns mit einem Blick in die modernen Medien selbst beantworten.

Wir sind hier bei dem Phänomen des „Bösen“ angelangt. Der Verführer, der seine Macht rücksichtslos zu seinen Gunsten missbraucht, der bedenkenlos mit den Ängsten und Sehnsüchten seiner Untergebenen spielt, der gnadenlos selbst die unvorstellbarsten Leiden und Opfer von ihnen verlangt, ist für uns zum Inbegriff und zur Verkörperung des „Bösen“ geworden, und ich bin davon überzeugt, dass das „Böse“ eine ureigenst menschliche Angelegenheit und Erfindung ist.
Das Tier kennt das „Böse“ nicht, denn es hat weder Bewusstsein noch Gewissen. Das Tier kann nicht ausbrechen aus seiner ihm vorgegebenen Bahn, es kann nur verwirklichen, was in ihm angelegt ist. Es befindet sich im Zustand naiver, natürlicher Unschuld. Auch der Bär, der in für uns vielleicht grausamer Weise ein junges Elchkalb reißt, lebt und bleibt in unschuldiger Einheit mit den ewigen, göttlichen Gesetzen der Schöpfung, denn er tut dies nur im Dienste seiner Arterhaltung und nicht aus Rache, Mordlust oder Heimtücke oder um seine Stärke und Überlegenheit zu beweisen. Er kann nicht ausbrechen aus der Rolle, die Mutter Natur ihm zugeschrieben hat. Er ist und bleibt Tier und kann nicht zum „Untier“ werden, auch wenn uns noch so viele Tier-Monsterfilme vom Gegenteil überzeugen möchten. - Es bleibt dabei: nur der Mensch kann ausbrechen aus der ihm von der Natur gegebenen Rolle. Nur er bringt es kraft seines Wissens um Gut und Böse, kraft auch seiner Freiheit, sich so oder anders zu entscheiden, fertig, vom Menschen zum „Unmenschen“ zu werden und all das zu tun, was gegen alle Logik und Vernunft, gegen Güte und Mitgefühl und nur zum Schaden seiner Mitmenschen, seiner Umwelt und schließlich seiner selbst dient.
Natürlich kann der Mensch seine eigenen bösen Absichten und Verhaltensweisen auch dem Tier antrainieren, denken wir nur an die Abrichtung von Kampfhunden etwa, deren Anlage zu Kampf- und Angriffslust er steigern und für seine Zwecke missbrauchen kann. Dennoch ist es ihm nicht möglich, das eigene „böse Ich“ der Kreatur wirklich einzuverleiben, da ja auch der aggressivste Kampfhund im Grunde genommen nur das tut, was natürlicherweise in ihm angelegt ist, in diesem Falle nämlich seinem Alpha-Tier zu gehorchen und es als seinen Rudelführer zu beschützen, und nicht etwa seinen eigenen Aggressionstrieb auszuleben. So ist in jedem Falle das Böse, das wir Menschen in einem Tier und seinem Verhalten sehen, etwas, das von uns selbst in es hineingelegt und hineininterpretiert wird.

Auf die Rolle, die der sogenannte „Weiße Mann“ bei der Besiedlung des Yukon-Gebietes gespielt hat, möchte ich hier nicht näher eingehen. Allzu rühmlich ist dieses Kapitel – wie die Geschichte gezeigt hat – ja nicht, war es doch neben den Segnungen, die es in Form von Fortschritt, Missionierung und den Errungenschaften der modernen Zivilisation brachte, auch verbunden mit neu eingeschleppten, vorher unbekannten und deshalb nur schwer zu heilenden Krankheiten, der Verbreitung des Alkoholismus, der Plünderung der Bodenschätze und den daraus resultierenden Umweltbelastungen, der Beschneidung von Würde und Rechten der Ureinwohner und dem zweifelhaften Ersetzen ihrer Selbständigkeit durch unser Konsum- Anspruchs- und Versorgungsdenken. Dazu Häuptling Seattle schon 1855 in vergleichbarer Lage:
„Unsere Kinder sehen ihre Väter gedemütigt und besiegt. Unsere Krieger wurden beschämt. Nach Niederlagen verbringen sie ihre Tage müßig – vergiften ihren Körper mit süßer Speise und starkem Trunk.“
Durch die Anerkennung ihrer ursprünglichen Rechte und deren Aufnahme in die neue kanadische Verfassung von 1982 ist das Selbstbewusstsein der „first nation people“ in den letzten Jahren wieder gewachsen. Selbstverwaltung, Rückbesinnung auf alte Traditionen und überlieferte Fertigkeiten geben Zeugnis davon.
Die Rolle, die der „Weiße Mann“ heute in solchen Gegenden, wie dem Yukon, spielen könnte und sollte, müsste mit Entschiedenheit darin bestehen, diese Menschen in ihrer Rück- und Selbstbesinnung auf ihre traditionellen Werte, auf ihre angeborene Ehrfurcht vor dem Leben und ihre ganzheitliche und geschwisterliche Sichtweise der Natur und ihrer Geschöpfe zu bestärken und zu unterstützen, sich selbst jene Denkweise zu eigen zu machen, und zusammen mit ihnen alles in seiner Kraft stehende zu tun, diese immer noch nahezu paradiesischen Lebensräume für sie, ihre Kinder und für die ganze Menschheit zu erhalten und zu bewahren.
Das einfache Leben
Das einfache Leben ist – um es vorwegzunehmen und gleich deutlich zu sagen – uns heutigen Menschen nicht mehr möglich. Es ist eine Fiktion, ein Wunsch, ein Traum – wenn auch ein wunderschöner!
Was aber ist das eigentlich, das „einfache Leben“? - Unser Dasein in der heutigen Zivilisation ist kompliziert und komplex geworden. Wir besitzen unendlich viele Dinge und werden zugleich von unheimlich vielen Dingen in Besitz genommen. Die Alltagswelt eines jeden von uns ist angefüllt mit unzähligen Gegenständen, kleinen und großen Besitztümern, die er braucht oder von denen er glaubt, sie brauchen zu müssen. Wir klammern uns an die Dinge, die wir haben – nicht zuletzt an das Geld – halten alles angstvoll fest und meinen, dadurch gehalten zu sein. Aber im Grunde genommen ist es umgekehrt: nicht wir haben die Dinge, sondern die Dinge haben uns! Wir sind der Überzeugung, dass wir über das Materielle herrschen und es uns von Sorgen und Not frei macht, dabei schleppen wir es als Last und Ballast mit uns herum und dienen ihm und seinen Gesetzmäßigkeiten.
Zitat von Lindolfo Weingärtner:
„Du klammerst dich an Dinge, die du hast,
hältst angstvoll fest und glaubst, du wirst gehalten:
Die Dinge haben dich – du schleppst die Last;
du meinst, du herrschst – und fronest den Gewalten!
Lass los, o Mensch, lass los, bevor der Tod
dir schließlich aufbricht die verkrampften Hände!
Gib dem Erlöser Raum! – Lös fremde Not!
Erlöstes bleibt! – Das Machwerk geht zu Ende!“
In unsere Welt dringt heutzutage eine Fülle von Nachrichten und Informationen, die wir gar nicht verkraften, ein Überangebot von Unterhaltungs- und Lebensmöglichkeiten, das wir gar nicht ausschöpfen können. So haben wir permanent das Gefühl, etwas zu verpassen, stets hinter etwas herlaufen zu müssen. Es liegt auf der Hand, dass Glück und Sinn des Lebens auf diese Weise nicht zu finden sind. Der ständige Stress unserer Tage, der wachsende Ekel vor den zunehmenden Zivilisationsschäden und die sich langsam einstellende Erkenntnis, dass wir auf dem so eingeschlagenen Weg nicht zufriedener, sondern immer unzufriedener werden, lässt in uns den Wunsch nach einem besseren, sinnvolleren und glücklicheren Leben aufkommen, einem Leben, das gerade nicht von einem „Mehr“ an Dingen und Möglichkeiten, sondern von einem diesbezüglich „Weniger“ bestimmt ist, das gerade aber so ein „Mehr“ an Inhalt, Sinn und Geborgenheit verspricht.
Um von der Theorie in die Praxis zu wechseln und diese Gedanken anschaulicher und greifbarer zu machen, möchte ich versuchen, ein Bild davon zu malen, wie ein solches, „einfaches“ Leben für mich etwa aussehen könnte. Da es sich hierbei, wie gesagt, nur um einen Traum, eine Vision handelt oder notgedrungen handeln muss, darf ich bei seiner Ausmalung auf so wesentliche, reale Dinge und Voraussetzungen wie finanzielle Absicherung, das Erlangen der gesetzlichen Genehmigungen und Bewilligungen, die Frage, ob ich den technischen und fachlichen Erfordernissen, den körperlichen und seelischen Ansprüchen sowie den klimatischen Herausforderungen eines solchen Unternehmens überhaupt entsprechen und ihnen auf Dauer tatsächlich gewachsen sein könnte, einfach verzichten und meinen Vorstellungen ungehindert freien Lauf lassen:
Am erhöhten Ufer des Dream-Lake steht zwischen dem Seeauslauf und der Mündung eines No-name-Baches hochwassersicher ein Cabin, weit genug entfernt von allen Störungen der Zivilisation, jedoch nahe genug gelegen, um notfalls deren Segnungen und Hilfen in Anspruch nehmen zu können. Das kleine, aus massiven Holzstämmen zusammengefügte Blockhaus schmiegt sich in einer Waldlichtung unauffällig an die es umgebenden nordischen Fichten an. Von seiner Anhöhe geht der Blick weit über den von bewaldeten Berghängen begrenzten See, an dessen kiesigem Ufer ein zuverlässiges Kanu vertäut liegt. Die niedrige Blockhütte selbst ist ausgestattet und eingerichtet mit allem, was der Mensch zur Befriedigung seiner täglichen Bedürfnisse und zum Überleben in der Wildnis braucht. Auch ist die Möglichkeit zur Verbindung mit der Außenwelt gegeben. Die gesamte Einrichtung ist auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet, jeder unnötige Schnickschnack fehlt.
Hier bin ich eingezogen mit Jagdausrüstung, Angelgerät, Mal- und Schreibutensilien, meinen liebsten Fach- und Unterhaltungsbüchern sowie den Lebens- und Überlebensmitteln, welche die Natur mir nicht zu bieten vermag. Hier will ich nun leben, will ich wirklich das Leben leben, hier will ich einfach „sein“. Hier sollen Hektik, Unrast, Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten und Ängste des Zivilisationslebens von mir abfallen, und stattdessen Selbstbewusstsein, Sicherheit und Unabhängigkeit in mir wachsen.Hier möchte ich im Verzichten auf alles Überflüssige das Wesentliche gewinnen. Hier will ich äußerlich ärmer und dadurch innerlich reicher werden. Hier will ich zur Ruhe kommen, zu mir selbst finden, eins werden mit mir selbst, mit meiner Umwelt, mit ihrem und meinem Schöpfer. Hier will ich erfahren, ob Henry DavidThoreau recht hat, wenn er sagt: „In der Wildnis liegt die Rettung der Welt. Von den Wäldern und von der Wildnis fließen die Kräfte und die Lebenselixiere, deren die Menschheit bedarf.“ Hier will ich die Stille des Sees genießen, die Majestät der Bergwelt bestaunen, will wie Erich Kästner „mit Bäumen wie mit Brüdern reden“ und sehen, wie die Jahreszeiten wechseln und die Natur sich verändert im Kreislauf des Jahres.
Mein Tagesablauf wird angefüllt sein mit Jagen, Fischen, Nachdenken, Malen, Lesen, Schreiben, Beeren- und Pilzesammeln, Exkursionen, Natur- und Tierbeobachtungen, aber auch mit Wasserholen, Holzhacken, Haus- und Reparaturarbeiten, Zubereitung der Mahlzeiten, Ruhen, Essen und Schlafen. Ich hätte nur für mich selbst zu sorgen und könnte mich ganz meinen Wünschen, Bedürfnissen und Lieblingsbeschäftigungen widmen.
Welch beglückende, paradiesische Vorstellung vom „einfachen Leben“, einem Leben in Freiheit, Schönheit, Unschuld und Einklang mit der Natur! - Bei allem Reiz, der von der Vorstellung des „einfachen Lebens“ ausgeht und bei aller Begehrlichkeit, die sie erweckt, erhebt sich jedoch innerlich sogleich die Frage: „Könnte und dürfte das sein? Schaffte ich das, und führte es, auf Dauer gesehen, zum Glück, so allein zu leben?I Ist es moralisch überhaupt vertretbar, ein solches, nur auf sich allein gestelltes und nur auf sich selbst bedachtes Leben zu führen?!“ Hier stellen sich meiner Meinung nach doch erhebliche Zweifel und Bedenken ein. Sehen wir einmal von geglückten, weil zeitlich begrenzten, Versuchen ab, aus dem normalen Alltag auszusteigen und ein Leben allein in Wildnis und Einsamkeit zu führen, so ergibt sich die erste Schwierigkeit, dies auf Dauer zu tun, schon aus der Tatsache, dass unser menschliches „Ich“ von Anfang an auf ein „Du“ angelegt ist. Wir Menschen sind von Natur aus keine Einzelwesen, sondern brauchen ein uns selbst entsprechendes Gegenüber. Davon berichtet schon der alte, biblische Schöpfungsmythos, wenn er dem erschaffenen Adam die weibliche Entsprechung Eva gegenüberstellt und in beide zugleich das Verlangen nach Vereinigung hineinpflanzt. Der Mensch – symbolisch dargestellt durch Adam und Eva – erhält hier aber noch ein weiteres Gegenüber, ein „Du“, das nun nicht mehr nur seinesgleichen ist, sondern ihn wesensmäßig übersteigt und dem gegenüber er verantwortlich ist, nämlich Gott, den Schöpfer, selbst. In diesem Sinne ist der Mensch „geschaffen zum Ebenbild Gottes“, wie es in der Bibel heißt.
Die Konsequenzen, die sich daraus für das ersehnte, scheinbar so paradiesische „einfache Leben“ ergeben, lauten zum einen: Ich kann nicht wirklich ohne den oder die anderen Menschen leben, ich brauche das „Du“, brauche ihr Gegenüber. Natürlich kann ein Einzelner rein physisch gesehen überleben, aber die Frage ist, wozu? - Für mich heißt das ganz praktisch: für wen schreibe ich, für wen male ich? Nur für mich selbst? Nur um mich selbst auszudrücken? Nur als Spiegelbild meiner eigenen Eitelkeiten? – Was bedeutet mir alles, wenn ich es nicht zeigen, nicht mitteilen, nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes „mit anderen teilen“ kann? – Landschaften, Tier- und Naturbeobachtungen, Angelabenteuer, gelungene Bilder und Zeilen sind schön, aber noch schöner sind sie, wenn ich sie mit jemand anderem gemeinsam sehen, erleben, betrachten und besprechen kann. Hier ist geteilte Freude wirklich doppelte Freude! – Das ist das Eine!
Zum anderen stellt sich einem egoistisch nur auf das eigene Heil ausgerichteten Leben ja doch auch die Gewissensfrage: „Wie steht es denn mit deiner Verantwortlichkeit gegenüber der Welt und dem Wohl deines Nächsten? Darfst du dich ihr einfach entziehen, ihr achselzuckend den Rücken kehren, dir selbst das schöne „einfache Leben“ gönnen und darüber all die Nöte, Probleme und Aufgaben unserer Welt vergessen, an deren Lösung auch du mitarbeiten könntest? Kannst und darfst du wirklich die überall auf der Erde hilfesuchend ausgestreckten Hände tatenlos übersehen?“

Wir spüren: nein, so geht es nicht! – Was bleibt also zum Schluss? – Bleibt jetzt nur die Erkenntnis: das „einfache Leben“ muss uns verwehrt bleiben, weil wir nicht mehr hinter die Gewohnheiten und Gegebenheiten unserer Verbrauchs- und Vergnügungsgesellschaft zurückkehren können, die Einsicht, dass wir den Platz nicht verantwortungslos verlassen dürfen, an den uns das Leben nun einmal gestellt hat, das Wissen, dass wir durch das, was die Bibel „Sündenfall“ nennt, den unschuldigen Zustand des Paradieses für immer verloren haben, und deshalb unter dem ungestillten und unstillbaren Verlangen nach dem Eins-Sein mit der Schöpfung, mit unseren Mitmenschen, mit uns selbst und mit dem Urgrund allen Seins leiden?!
Ist damit der Traum vom einfachen Leben jetzt endgültig zu Ende geträumt? Ist er an der harten Wirklichkeit zerplatzt wie eine bunt schillernde Seifenblase?!- Nein, ich denke: nicht! – Ich träume ihn immer noch und ich bin dankbar dafür, dass es ihn gibt! Ich träume ihn immer dann, wenn ich an meinen Angeltagen hier an unseren mitteleuropäischen Flüssen die Natur und ihre Geschöpfe mit den Augen und der Betrachtungsweise eines Häuptling Seattle sehen und sie mit der Ehrfurcht seines Herzens behandeln kann.
Ich träume ihn immer dann, wenn ich – an meinem Schreibtisch sitzend und das Holz in meinen Händen haltend – an die vergangenen und hoffentlich kommenden Tage und Erlebnisse im Yukon denke.
Und ich werde ihn immer dann träumen, wenn ich ihn zumindest ansatz- und bruchstückweise in die Wirklichkeit umsetzen kann, weil ich wieder dort bin, wo ich das Yukon-Holz einst gefunden habe.

Ende